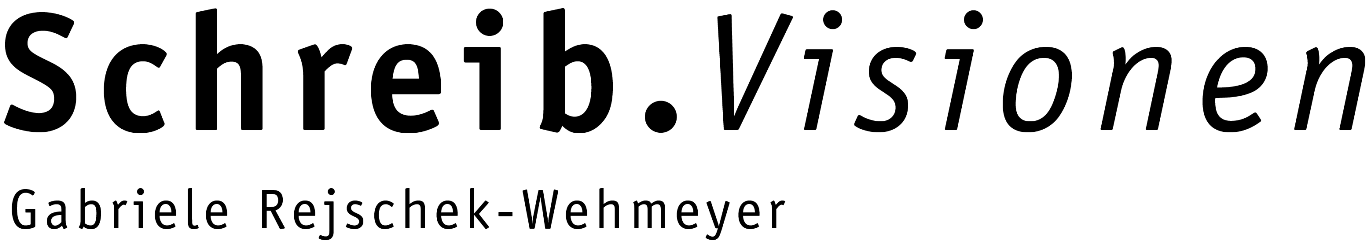Ich starrte auf den Bildschirm meines Laptops. Immer wieder fielen mir inzwischen die Augen zu, sodass man hätte annehmen können, ich würde an einem Online-Kursus für autogenes Training oder Schlafoptimierung teilnehmen. Dabei war ich an diesem Tag kurz vor Weihnachten seit Stunden einfach nur auf der Suche nach den schönsten Weihnachtsgeschenken. Doch einfach war eben manchmal doch nicht einfach.
Wohin ich auch scrollte, so viel wie ich auch auf die besten Weihnachtsgeschenke für Männer, für Kinder zwischen zwei und fünf Jahren, für Seniorinnen mit und ohne Zähne, für Menschen, die man am liebsten auf den Mond geschossen hätte oder auf die ultimative Schnäppchenecke klickte, je weniger wusste ich, womit ich meine Lieben denn nun beschenken wollte. Stattdessen ploppte alle gefühlte drei Sekunden ein Werbebanner auf mit der Botschaft:
Wie Sie am schnellsten Ihr Bauchfett verlieren
Doch weder mit noch ohne Bauchfett kam ich meinem Ziel näher. Und dabei hatte ich mir für dieses Weihnachtsfest fest vorgenommen, meiner Familie und meinen Freunden und auch meinen Nachbarn eine besondere Freude zu machen – so wie ich es selbst beim letzten Weihnachtsfest erleben durfte.
Für einen Moment schaute ich auf die Glaskugel, die auf meinem Schreibtisch stand. Es gab nur wenige Dinge, über die ich mich auch jetzt, fast ein Jahr später, so freute wie über diese kleine Kugel und ihre ganz eigene Botschaft. Unwillkürlich lächelte ich. Dann schaute ich wieder auf den Bildschirm voller verheißungsvoller Versprechen.
Was gehörte zu den Dingen, über die sich Menschen wirklich freuten? Glaubte man der Plattform, auf der ich mich gerade befand, musste das Ding auf jeden Fall einen Stecker haben. Oder aber einen leistungsstarken Akku.
Ich war auch schon kurz davor, einen Echo Dot zu kaufen. Und dann wäre Alexa dran: Alexa, was schenke ich meinem Herzensmann? Alexa, was braucht meine Mutter wirklich? Und, Alexa, was schenke ich meiner kleinen Nichte, die von ihren Eltern sowieso alles bekommt?
Alexa, was macht Freude wirklich groß?
Ich bezweifelte, dass Alexa mir helfen konnte, also beschloss ich, mein Weihnachtseinkaufserlebnis traditionell auszuleben. Ich würde in die Stadt fahren. Ich würde mich inspirieren lassen vom richtigen Leben. Sofort fühlte ich mich wieder wach.
Schon eine Dreiviertelstunde später fand ich mich in einem Kaufhaus wieder. Eingehüllt in den Duft von gebrannten Mandeln und Marzipan und der Melodie von Jingle Bells lief ich durch die Abteilungen, als wäre ich auf einem unbekannten Wanderweg: Wo, bitte schön, geht es hier zu den Geschenken, die wirklich Freude machen?
Ich wanderte weiter und weiter. Lichtschwerter. Puzzles mit und mit noch mehr Teilen. Unterwäsche in Mini- und in Übergrößen. Gläser. Bettwäsche mit und ohne Glitzer. Elektrotechnik. Parfum. Beheizbare Tennisschläger. Lichterketten mit Dauer- und mit Wechsellicht . Ich schluckte. Irgendwie war das richtige Leben auch nicht besser.
Dann holte ich Luft, tief Luft
Ich würde es ja wohl noch schaffen, bei dieser Unmenge an Dingen etwas zu finden, was die Menschen, die ich beschenken wollte, zum Lächeln brachte! Schließlich schien das allen anderen – jedenfalls gemessen an den unendlichen Schlangen an den Kassen – auch zu gelingen.
Ich ließ die Namen meiner Lieblingsmenschen durch meinen Kopf gehen: Womit könnte ich ihnen eine ganz besondere Freude machen? Was könnte eine Weihnachtsgabe für meine Nachbarn sein – ein Geschenk, das sein Dasein nicht als hundertfünfunddreißigster Weihnachtsdekoartikel zukünftig in Keller oder Dachboden fristen würde, sondern wirklich, wirklich Freude schenkte?
Ich seufzte. Ich hatte in den letzten Wochen viel gearbeitet. Da war diese Workshopreihe, die ich selbst entwickelt hatte. Es hatte Spaß gemacht. Viel Spaß. Und ich freute mich über die vielen, vielen guten Rückmeldungen. Allerdings hatte ich mir nicht die Zeit genommen, auch nur ein einziges Geschenk zu kaufen oder mir schon wenigstens einmal darüber Gedanken zu machen. Ich brauchte also noch für viele Menschen eine Weihnachtsgabe.
Wieder dachte ich an das wunderbare Geschenk, das mir ein Unbekannter im letzten Jahr kurz vor Weihnachten vor die Tür gestellt hatte. Die Kugel auf meinem Schreibtisch. Die kleine Glaskugel, in der ich mich selbst spiegelte und die mich mit ihrer Botschaft, auf mich selbst zu schauen, durch dieses Jahr begleitet hatte. Sie hatte mir regelmäßig den Weg zu mir selbst gewiesen. Zu dem, was mir wirklich wichtig war. Zu dem, was ich wirklich wollte. Zu dem, was mich glücklich machte.
Wie gerne würde ich meinen Freunden ein solch wunderbares Geschenk machen! Doch wie würde ich wissen, dass ich es gefunden hatte?
Zweifelnd schaute ich mich um. Rasierschaum, Socken, Schuhe, Koffer, Bücher – dies waren nur wenige der möglichen stecker- und akkulosen Alternativen. Mit Stecker gab es Bohr- oder Kaffeemaschinen, mit Akku I-Pad oder Rasentrimmer. Alexa, hilf, dachte ich. Wahllos griff ich in dem Wühlkorb vor mir nach ein paar Socken mit Rentier.
Dabei schaute ich kurz auf einen Jungen, der auf der anderen Seite des Korbes stand. Er mochte vielleicht elf oder zwölf 12 Jahre alt sein. Er hatte ein rundes, freundliches Gesicht. Mit großen runden Augen. Und er lächelte. Wenn ich mich nicht täuschte, trug er diesen ganz besonderen Ausdruck von Kindern, die das Down-Syndrom haben. Doch da war etwas ganz anderes, das mich irritierte. Der Junge ließ sich weder von dem Mann im Weihnachtsmannkostüm nur wenige Schritte weiter ablenken, noch von all den Dingen, die es hier zu kaufen gab. Seine Aufmerksamkeit schien allein dem Menschen neben ihm zu gelten, den er mit weit geöffneten Augen anschaute.
„Mama“, sagte der Junge nun
Selten hatte ich dieses Wort in einer solch warmen Betonung gehört. Selten hatte ich so klare offene Augen gesehen.
Der Junge blickte weiter zu seiner Mutter. Ich folgte seinem Blick. Die Frau war vielleicht gut vierzig, sie trug einen Zopf und ein paar Einkaufstüten. Müde, sie sieht müde aus, dachte ich. Gerade zeigte sie auf ein dunkelblaues Halstuch mit goldenen Sternen.
„Ob das deiner Freundin Maja gefallen würde?“, fragte sie nun, ohne den Jungen anzuschauen. Ich hatte den Eindruck, als hätte sie eine solche Frage heute schon öfter gestellt. Willkommen im Club, dachte ich. Immerhin schien ich nicht die einzige zu sein, die etwas verzweifelt durch das Kaufhaus irrte.
„Mama“, wiederholte der Junge.
Der Blick der Frau war noch immer bei den Socken und Tüchern, die aus dem Korb quollen. Und dann sagte sie, mit einem Blick auf die Uhr, die neben der Rolltreppe hing: „Wir müssen uns beeilen. Wir müssen zum Bus. Ich muss auch noch etwas zu essen machen. Und dann auch noch die letzte Weihnachtspost. Und die Wäsche wartet noch.“
Mehr als Müdigkeit, dachte ich und schluckte. Zu gut erinnerte ich mich an ein Jahr, in dem ich mich selbst immer nur müde gefühlt hatte. So viele Aufgaben. So viel zu tun.
Der Junge zupfte am Mantel seiner Mutter. Sein Blick führte noch immer zu ihren Augen. Und jetzt, jetzt endlich blickte die Mutter auch ihn an.
Der Junge erhob seine Stimme: „Ich möchte dir etwas sagen, Mama. Etwas ganz Wichtiges.“
„Was ist denn so wichtig?“ fragte die Mutter. Ihre Augen begegneten sich. Und dann, in diesen Augenblick, sprach der Junge:
„Du bist so schön, Mama“, sagte er mit seiner hellen, klaren Stimme. Dabei lächelte er auch jetzt. Nein, er strahlte. Er strahlte, als hätte er gerade das schönste Weihnachtsgeschenk überhaupt bekommen. Und dann drückte er seinen Kopf an ihre Schulter.
Ich schluckte schon wieder und kam mir vor wie jemand, der an der Tür lauschte. Doch ich konnte nicht anders. Ich blieb stehen und schaute weiter zu der kleinen Familie. Und trotz des Gewirrs um mich herum, trotz der penetranten Töne irgendwelcher Weihnachtslieder hatte ich das Gefühl, dass es nur noch das hier gab. Diese Weihnachtsbegegnung hier im Kaufhaus, vor einem Korb voller Stoffwaren.
„Danke“, hörte ich nun die viel leisere Stimme der Mutter. Und noch einmal, etwas lauter: „Danke, mein Schatz.“ Bei ihren Worten begann auch sie nun zu lächeln und es schien, als färbte die Freude ihr Gesicht, als fiele die Erschöpfung von ihr ab, als gäben dieser einzige Satz, diese wenigen Worte des Jungen ihr die Leichtigkeit des Tages zurück. Ich sah, wie sie ihren Rücken streckte und Luft holte. Und dann bückte sie sich zu dem Jungen, schaute ihm in die Augen und sagte:
„Weißt du was, ich glaube, Maja braucht gar kein neues Halstuch. Was hältst du davon, wenn wir statt Geschenken schon heute die Orangen kaufen?“
„Ja!“, rief der Junge begeistert, „ja, bitte!“. Dann hob er seine Arme neben sich wie die ausgebreiteten Flügel eines Engels und schaute seine Mutter mit seinen großen runden Augen an, als hätte er schon wieder etwas Wichtiges zu verkünden und sagte:
„Dann wird schon jetzt Weihnachten. Weihnachten wird, wenn es nach Orangen riecht.“
Und dann lachte er und die Mutter lachte auch, beide lachten laut, so laut, dass der Weihnachtsmann ein paar Schritte weiter fast seinen Text vergaß.
Als die beiden schon längst nicht mehr zu sehen waren, hielt ich noch immer die Socken mit eingestricktem Rentier in der Hand. Noch immer hörte ich die Stimme des Jungen. Noch immer sah ich diesen Blick, mit dem er die Mutter angeschaut hatte. Und dann, als hätte er genau gewusst, was seine Mutter jetzt am dringendsten brauchte, dieser Satz:
„Du bist so schön, Mama.“
Und dann: Das Strahlen in seinem Gesicht. Das wie ein Zauber plötzlich auch das Gesicht der Mutter färbte. Ich legte die Socken samt Rentier zurück in den Korb. Plötzlich wusste ich, was ich verschenken wollte. Plötzlich wusste ich, was es war, das Freude wirklich groß machte. Der Junge, dieser kleine Junge, hatte es mir vorgemacht.
Und wieder einmal war es einfach. Warum war ich nicht selbst längst darauf gekommen?
Der Junge hätte quengeln, die Mutter zu den Spielzeugen ziehen, seine eigenen Wünsche nach oben legen können, doch stattdessen hatte er seine Mutter angeschaut. Wirklich angeschaut. Und dabei hatte er gesehen, was für diesen anderen Menschen hier gerade, zwischen all dem, was man tun möchte oder muss, wirklich wichtig war. Und hatte ihr dann genau das gegeben. Einen Moment der Anerkennung, eingehüllt in wunderbare Kinderworte.
Das Geschenk, das Freude wirklich größer machte:
Einen Menschen anschauen
Wirklich anschauen. Absehen von den eigenen Bedürfnissen. Absehen vom eigenen Glück. Und dann dem Menschen geben, was er am allermeisten braucht. Das, was gerade möglich ist.
Ich hatte in diesem Jahr vor allem auf mich geschaut. Ich hatte in mich hineingehört, was mir selbst wichtig war. Weil ich das viel zu oft vergessen hatte. Ich hatte mehr von dem getan, was mir Freude machte. Dieses Jahr war mein Jahr gewesen und ich war glücklich darüber.
Doch hatte ich dabei zugleich genügend die Menschen um mich herum gesehen? Hatte ich immer wieder innegehalten, um einen Menschen so anzuschauen, wie es der Junge mit seiner Mutter hier im Kaufhaus gemacht hatte? Hatte ich bei meiner Weihnachtseinkaufsaktion versucht zu spüren, was meine Eltern, meine Freunde gerade vor allem brauchten? Hatte ich hingeschaut, was wichtig war, wirklich wichtig war für meine Nachbarin? Wusste ich, was wichtig war für meine Nichte? Und was ich ihr davon geben könnte?
Beim Gedanken an Lara grinste ich. Ich hatte so eine Ahnung, was sie selbst dazu sagen würde.
Meine Nichte würde sagen: Fußball. Spiel mit mir Fußball. Du weißt ja, Mama und Papa finden Fußballspielen blöd. Aber für mich, für mich ist es der Himmel. Und dann würde sie ihren Ball holen und strahlen, wie der Junge vorhin seine Mutter angestrahlt hatte.
Und ich selbst? Ich selbst würde wahrscheinlich auch strahlen. Weil ich ohne meine Nichte wahrscheinlich nie erlebt hätte, wie es ist, wieder Kind zu sein.
Anschauen verändert. Ich konnte wie der Junge allein mit meiner Offenheit für den anderen dafür sorgen, dass Freude einfach größer wurde. Mit einem Fußballspiel. Mit einem Lächeln oder einem Wort, das dem anderen galt. Und vielleicht noch mit ganz anderen einfachen Gesten der Gegenseitigkeit. Dabei war ich mir sicher, dass ich spüren würde, was ich dem anderen von mir selbst geben konnte. Und ich wusste auch schon, wer mir dabei helfen würde. Mit einem großen, breiten Lächeln verließ ich das Kaufhaus.
Wieder bei mir zuhause, schaltete ich meinen Laptop aus. Ich brauchte ihn nicht mehr. Jedenfalls nicht, um auf die schönsten Weihnachtsgeschenke zu stoßen.
Mein Weihnachtsgeschenk
Einen Menschen anschauen. Innehalten beim anderen. Und dann spüren, was ich diesem Menschen geben konnte, um seiner Welt mehr Lächeln zu geben.
Für diese Weihnachtsgabe brauchte ich weder eine Online-Plattform noch ein Kaufhaus. Ich brauchte nur mich und einen offenen Blick für die Welt. Und doch war ich mir sicher: Ich hatte eins der schönsten Geschenke gefunden, das man einem anderen Menschen und sich selbst machen konnte.
Und, auch wenn noch gar nicht Weihnachten war, konnte ich schon heute beginnen, es zu verschenken. Weil anschauen immer geht.
Und zu Weihnachten selbst? Auch das hatte mir der Junge gezeigt: Zu Weihnachten würde ich allen eine Orange schenken. Weil Weihnachten wird, wenn es nach Orangen riecht. Eine Orange von einer Hand in die andere geben und Weihnachten werden lassen. Weil Weihnachten selbst das größte Geschenk war. Ich lächelte.
Und dann ging ich zu meinem Schreibtisch. Nun hatte ich noch etwas ganz anderes zu tun. Behutsam nahm ich meine Glaskugel in meine Hände. Wie immer spiegelte ich mich darin. Wie immer erinnerte sie mich daran, bei mir zu sein. Und gleichzeitig, wenn ich sie weit genug von mir hielt: Das Leben um mich herum:
Der Spiegel dieser Welt
Es war wichtig, bei mir zu sein. Und genauso wichtig, beim anderen. Innen und außen. Beides, beides gehörte einfach zusammen. Diese Kugel hatte mir geholfen, mich selbst zu sehen. Sie würde mir ebenso helfen, das Ganze zu sehen. Langsam ging ich mit meiner Kugel zum Fenster. Hier sollte sie ihren neuen Platz bekommen. Hier konnte sie einfangen, was außer mir noch war. Ich und du. Ich und wir. Ich und ihr. Ich und die Welt.
In meinem Geist sah ich noch einmal diesen Jungen. Ich sah seine großen Augen, die nichts anderes suchten als die Augen seiner Mutter. Ich sah diesen kleinen Jungen mit seinen ausgebreiteten Engelsarmen, der wusste, was Freude wirklich brauchte.
Und jetzt, jetzt würde ich in die Küche gehen und eine Orange essen. Weil Weihnachten wird, wenn es nach Orangen riecht.
Geschichte: Kirsten Schwert, Foto: PhotoSG / Adobe Stock